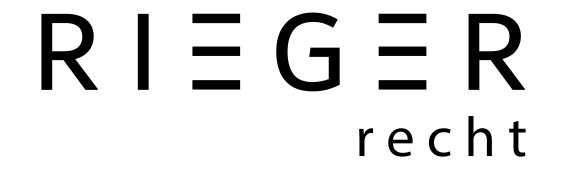Der Begriff „fiktives Einkommen“ ist im österreichischen Recht nicht explizit definiert, wird aber häufig im Rahmen der Unterhaltsbemessung verwendet. In diesem Kontext wird untersucht, welches Einkommen eine Person hypothetisch erzielen könnte, wenn sie ihre Erwerbsbemühungen optimieren würde. Dies spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn der Unterhaltspflichtige behauptet, nicht genügend reales Einkommen zu haben, um Unterhaltszahlungen leisten zu können.
Im Allgemeinen wird im Unterhaltsrecht davon ausgegangen, dass der Unterhaltspflichtige sich redlich bemühen muss, ein ausreichendes Einkommen zu erzielen. Wenn das tatsächliche Einkommen unter dem liegt, was er realistischerweise verdienen könnte, kann das Gericht ein fiktives Einkommen bei der Berechnung des Unterhaltsanspruchs ansetzen. Dabei berücksichtigt das Gericht Qualifikationen, bisherige berufliche Tätigkeiten sowie die Arbeitsmarktsituation (§ 94 ABGB).
Eine weitere Anwendung findet das Konzept auch im Arbeitsrecht, wenn etwa Schadensersatzansprüche wegen entgangenen Verdiensts diskutiert werden. Hierbei wird berechnet, welchen Verdienst der Geschädigte hypothetisch erzielt hätte, wenn das schädigende Ereignis, wie z.B. eine unberechtigte Kündigung, nicht eingetreten wäre.
In all diesen Fällen dient das fiktive Einkommen als Maßstab dafür, was angesichts der Umstände als angemessenes wirtschaftliches Potenzial einer Person betrachtet werden kann. Das Ziel ist dabei, eine gerechte Lösung zu finden, die sowohl die Interessen des unterhaltsberechtigten als auch des unterhaltspflichtigen Teils wahrt.
Abschließend lässt sich sagen, dass fiktives Einkommen im österreichischen Recht kein feststehender Begriff mit spezifischem normativen Inhalt ist, sondern vielmehr ein Instrument zur gerechten Beurteilung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit darstellt.