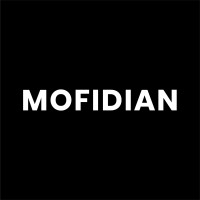Im österreichischen Strafprozessrecht wird der Begriff „Aussage gegen Aussage“ verwendet, um Situationen zu beschreiben, in denen es im Wesentlichen um die Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit der widersprüchlichen Aussagen des Beschuldigten und eines Belastungszeugen geht. Diese Konstellation erfordert eine besondere Sorgfalt bei der Beweiswürdigung, da keine weiteren unmittelbaren Beweismittel vorliegen, die die eine oder andere Darstellung unterstützen können.
Gemäß der Strafprozessordnung (StPO) ist das Gericht verpflichtet, alle Beweise frei zu würdigen (§ 258 StPO). Das bedeutet, dass das Gericht die gesamte Beweisaufnahme unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalles und nach seiner „freien Überzeugung“ zu beurteilen hat. Dabei spielen auch die allgemeinen Lebens- und Erfahrungsgrundsätze eine wesentliche Rolle. Es gibt keine gesetzlichen Regeln darüber, welche Beweise höher zu bewerten sind, sondern das Gericht hat die Aufgabe, in freier Überzeugung unter Berücksichtigung aller Beweise und Indizien zu entscheiden.
In einer „Aussage gegen Aussage“-Situation ist das Gericht daher besonders gefordert, die Glaubwürdigkeit der Zeugen und des Angeklagten sorgfältig zu prüfen. Faktoren, die dabei berücksichtigt werden können, beinhalten die Konsistenz und Detailliertheit der Aussagen, das Verhalten der Beteiligten vor und nach dem Vorfall, mögliche Motive zur Falschbelastung oder Wahrheit und die psychische Verfassung der Beteiligten. Zudem können indirekte Beweismittel oder objektive Indizien, wie etwa Verletzungen oder andere Sachbeweise, ergänzend herangezogen werden, um die Glaubhaftigkeit einer Aussage zu stützen oder zu widerlegen.
Es ist Aufgabe des Richters, alle vorliegenden Informationen zu einem Gesamtbild zu verdichten, das eine schlüssige Urteilsfindung ermöglicht. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass in einem „Aussage gegen Aussage“-Fall eine Verurteilung ausgeschlossen ist. Vielmehr muss die Beweislage insgesamt so überzeugend sein, dass das Gericht zu einer über jeden vernünftigen Zweifel erhabenen Überzeugung von der Schuld oder Unschuld des Angeklagten gelangt. Sollte dies nicht möglich sein, ist im Zweifel für den Angeklagten zu entscheiden (in dubio pro reo), was ebenfalls ein Grundpfeiler des österreichischen Strafrechts darstellt.