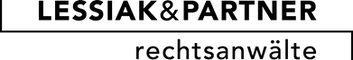Der Begriff „Corpus Juris Civilis“ bezieht sich ursprünglich auf das umfassende Werk der römischen Rechtssammlungen, das im 6. Jahrhundert unter dem oströmischen Kaiser Justinian I. kodifiziert wurde. Dieses Werk besteht aus den Institutiones, den Digesten oder Pandekten, dem Codex Iustinianus und den Novellae. Diese Sammlung bildete die Grundlage für das kontinentaleuropäische Zivilrecht und beeinflusste auch die Rechtsentwicklung in Österreich.
Im österreichischen Recht selbst wird der Begriff „Corpus Juris Civilis“ nicht direkt verwendet, da das österreichische Zivilrecht primär auf dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) basiert, welches 1811 in Kraft trat. Das ABGB ist eine umfassende Kodifikation des österreichischen Privatrechts, die durch die historische Rechtsentwicklung beeinflusst wurde, darunter natürlich auch durch das römische Recht, welches im Corpus Juris Civilis umfassend dokumentiert ist.
Das ABGB selbst ist in drei Hauptteile gegliedert: Der erste Teil regelt das Personenrecht, der zweite das Sachenrecht und der dritte das gemeinsame Bestimmungen. Diese Struktur zeigt, wie das System einer zivilrechtlichen Kodifikation von den Prinzipien beeinflusst wurde, die ursprünglich im römischen Recht entwickelt wurden.
Ein konkretes Beispiel für den Einfluss des römischen Rechts im ABGB ist die Vertragsfreiheit, die durch § 859 ABGB festgelegt wird. Diese bepstimmt, dass ein rechtsgültiger Vertrag durch eine übereinstimmende Willenserklärung zustande kommt, was ein Prinzip ist, das im römischen Recht stark ausgeprägt war.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass das „Corpus Juris Civilis“ im österreichischen Recht keine direkte Rechtsquelle ist, aber einen indirekten Einfluss auf die Entwicklung des österreichischen Zivilrechts und die Formulierung des ABGB hatte. Dies zeigt sich in den Prinzipien und der allgemeinen Systematik des österreichischen Privatrechts.