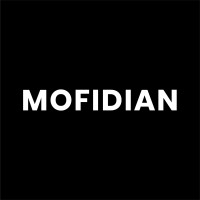Das Faustpfandrecht ist ein für das österreichische Recht typisches Rechtsinstitut und wird im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) geregelt. Es handelt sich dabei um ein Pfandrecht, bei dem eine bewegliche Sache zur Sicherung einer Forderung übergeben wird. Der wesentliche Unterschied zum sogenannten besitzlosen Pfandrecht liegt darin, dass beim Faustpfandrecht der Pfandgegenstand tatsächlich an den Pfandgläubiger oder eine dritte Person übergeben werden muss, was Besitzkonstitut bedeutet.
Die Vorschriften betreffend das Faustpfandrecht finden sich insbesondere in den Paragraphen §§ 447 bis 460 ABGB. Den Vorgaben zufolge entsteht ein Faustpfandrecht durch einen Pfandvertrag sowie durch die Übergabe der zu verpfändenden beweglichen Sache. Diese Übergabe bewirkt, dass der Pfandgläubiger – oder ein Dritter, der für ihn fungiert – die tatsächliche Gewalt über den Gegenstand erlangt.
Ein weiteres wichtiges Merkmal des Faustpfandrechts ist das Prinzip der Akzessorietät, was bedeutet, dass das Pfandrecht untrennbar mit der gesicherten Forderung verbunden ist. Erlischt die Forderung, erlischt auch das Pfandrecht. Das Faustpfandrecht gibt dem Gläubiger ein Recht auf bevorzugte Befriedigung, falls der Schuldner seine Verbindlichkeiten nicht erfüllt.
Darüber hinaus ist im österreichischen Recht auch die sogenannte Selbsthilfeverwertung durch den Pfandgläubiger geregelt. Sollte der Schuldner der gesicherten Forderung nicht nachkommen, hat der Gläubiger das Recht, den verpfändeten Gegenstand zu verwerten. Dies geschieht in der Regel durch eine öffentliche Versteigerung, die von einem Gericht oder einem Gerichtskommissär durchgeführt wird.
Zusammenfassend ist das Faustpfandrecht im österreichischen Recht ein gesetzlich verankerter Mechanismus, der die Rechte des Pfandgläubigers sichert, indem er die direkte Übergabe der verpfändeten Sache fordert und so einen tatsächlichen Zugriff im Falle der Nichterfüllung der gesicherten Leistung ermöglicht.