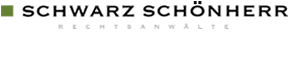Im österreichischen Recht versteht man unter dem Begriff „Folgeschaden“ einen Schaden, der nicht unmittelbar aus einem schädigenden Ereignis resultiert, sondern als mittelbare Konsequenz daraus entsteht. Solche Schäden sind oft nicht sofort erkennbar, sondern treten erst zeitlich verzögert auf. Ein klassisches Beispiel wäre eine Verletzung, die später zu weiteren medizinischen Komplikationen führt.
In der Regel werden Folgeschäden im Rahmen des Schadenersatzrechts behandelt. Hier ist insbesondere das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) relevant. Ein Grundprinzip zur Geltendmachung eines Folgeschadens ist die Kausalität zwischen dem ursprünglichen schädigenden Ereignis und dem später auftretenden Schaden sowie das Verschulden des Schädigers.
Der § 1293 ABGB definiert Schaden als jeden Nachteil, den jemand an Vermögen, Rechten oder seiner Person erleidet. Der Begriff des Schadens umfasst sowohl den unmittelbaren Schaden (direkt aus dem Ereignis resultierend) als auch den mittelbaren Schaden (Folgeschaden). Auch psychische Beeinträchtigungen können als Folgeschäden geltend gemacht werden, wenn sie in einem ausreichenden Kausalzusammenhang mit dem schädigenden Ereignis stehen.
Auch § 1311 ABGB kann eine Rolle spielen, da er die Ersatzfähigkeit von Schäden regelt, und zwar in dem Sinne, dass der Schädiger für alle von ihm verursachten Folgen haften muss, solange sie nicht völlig außerhalb der allgemeinen Lebenserfahrung liegen.
Ein weiteres relevantes Prinzip ist die sogenannte Vorteilsausgleichung, die besagt, dass Vorteile, die der Geschädigte durch das schädigende Ereignis erhält, mit dem Schaden verrechnet werden müssen. Diese Regel kann also auch bei der Berechnung von Ansprüchen für Folgeschäden berücksichtigt werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Folgeschäden im österreichischen Recht unter den allgemeinen Vorschriften des Schadenersatzrechts subsumiert werden, wobei der kausale Zusammenhang und das Verschulden zentrale Elemente sind.