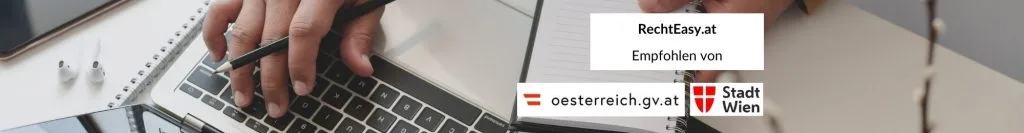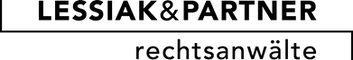Der Begriff „Grundsatz der Diskontinuität“ ist im österreichischen Recht nicht gebräuchlich und wird hauptsächlich im deutschen parlamentarischen Kontext verwendet. In Österreich existiert ein entsprechender Begriff oder eine explizite rechtliche Regelung für die Diskontinuität von Gesetzesvorhaben nicht.
Im österreichischen Parlamentarismus wird jedoch ein ähnliches Prinzip stillschweigend angewandt. Es bedeutet, dass mit dem Ende einer Gesetzgebungsperiode alle noch nicht verabschiedeten Gesetzesvorhaben verfallen. Bei einer neuen Gesetzgebungsperiode müssen die Vorhaben von Grund auf neu eingebracht, diskutiert und verabschiedet werden. Dies ist jedoch mehr eine übliche Praxis als eine explizit festgeschriebene Regel.
Das österreichische Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) regelt die Gesetzgebungsperiode des Nationalrats, ohne jedoch den Begriff der Diskontinuität direkt zu benennen. Die Legislaturperiode des Nationalrats beträgt laut Art. 27 B-VG fünf Jahre, nach deren Ablauf Neuwahlen notwendig sind. Eine Neuwahl setzt die Arbeit des neuen Nationalrats von Neuem an, wobei die verschiedenen Fraktionen ihre legislative Agenda erneut aufgreifen müssen.
In der Praxis sorgt dieser indirekte Diskontinuitätsgrundsatz für eine Art Reset der gesetzlichen Agenda mit dem Ende einer Legislaturperiode. In Österreich ist es üblich, dass Gesetzesentwürfe, die am Ende einer Legislaturperiode noch nicht verabschiedet wurden, entweder in der neuen Periode wieder aufgerollt oder verworfen werden, sofern sie nicht sofortige Dringlichkeit besitzen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Grundsatz der Diskontinuität im österreichischen Rechtssystem mehr eine politische und praktische Konvention als eine gesetzlich verankerte Regel ist. Es dient dazu, einen klaren Schnitt zwischen den Legislaturperioden zu machen und sicherzustellen, dass nach einer Wahl neue Prioritäten gesetzt werden können.