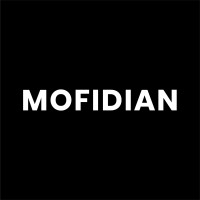Im österreichischen Recht gibt es nicht einen spezifischen Begriff „Knebelungsvertrag“ in der Gesetzgebung, wie er im deutschen Recht bekannt ist. Ein Knebelungsvertrag wird in der Regel als ein Vertrag verstanden, der eine Partei in unangemessener Weise einschränkt oder belastet, was gegen Grundsätze der Fairness und des rechtlichen Schutzes vor Ausbeutung verstößt. Im österreichischen Recht können solche Situationen unter verschiedene rechtliche Konzepte und Bestimmungen fallen.
Ein wichtiger Bezugspunkt wäre § 879 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB), der sich mit der Sittenwidrigkeit von Verträgen befasst. Nach § 879 Abs 1 ABGB ist ein Vertrag nichtig, wenn er gegen die guten Sitten verstößt. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine Vertragspartei in ein so starkes Ungleichgewicht gegenüber der anderen gebracht wird, dass dies eine sittenwidrige Ausnutzung darstellt. Besonders sittenwidrig sind Verträge, die einer Partei praktisch keinen freien Willen lassen oder sie übermäßig benachteiligen.
Weiters findet das Wucherverbot Anwendung, das ebenfalls in § 879 Abs 2 Z 4 ABGB geregelt ist. Ein Vertrag kann sittenwidrig und somit nichtig sein, wenn die Notlage, den Leichtsinn, die Unerfahrenheit oder die Willensschwäche einer Partei ausgenutzt wird und dabei ein auffallendes Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung entsteht.
Zusätzlich können Verbraucherschutzbestimmungen im Konsumentenschutzgesetz (KSchG) herangezogen werden, insbesondere bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die eine unangemessene Benachteiligung des Verbrauchers darstellen könnten (§ 6 KSchG).
In einem weiter gefassten rechtlichen Kontext sind auch die Grundsätze des Wettbewerbsrechts relevant, insbesondere wenn ein Vertrag darauf abzielt, den Wettbewerb unzulässig zu beschränken. Auch das Kartellrecht kann ins Spiel kommen, wenn der Vertrag wettbewerbsbeschränkende Klauseln enthält.
In der Praxis kommt es bei der Beurteilung, ob ein Vertrag als „Knebelungsvertrag“ angesehen wird, auf eine detaillierte Analyse des konkreten Vertragstextes und der gesamten Umstände des Vertragsabschlusses an. Wesentlich ist die Beurteilung, ob ein auffallendes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Verpflichtungen besteht oder die Freiheit einer Partei unrechtmäßig eingeschränkt wird. Solche Verträge können dann gegenüber einer gerichtlichen Überprüfung keinen Bestand haben und es besteht die Möglichkeit ihrer Anfechtung oder Nichtigkeitserklärung.