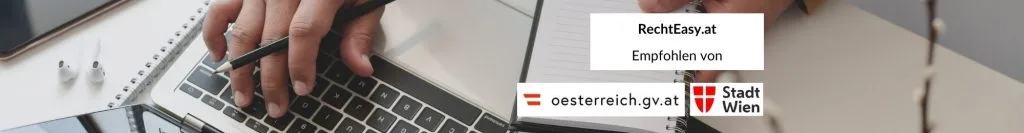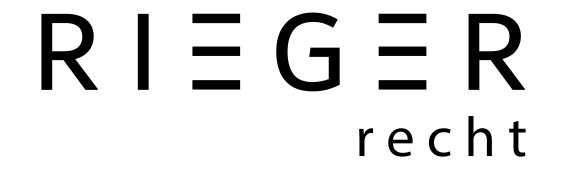Der Begriff „Ne ultra petita partium“ ist insbesondere im österreichischen Zivilprozessrecht von Bedeutung. Er bedeutet, dass ein Gericht nicht mehr zusprechen darf, als von den Parteien beantragt wurde. Diese Grundregel stellt sicher, dass die Urteile der Gerichte innerhalb des Rahmens der Anträge der Parteien bleiben und das Prinzip der Dispositionsmaxime beachtet wird.
Gemäß § 405 ZPO (Zivilprozessordnung) ist das Gericht verpflichtet, seine Entscheidung auf Grundlage der Anträge und des Vorbringens der Parteien zu fällen. Das bedeutet, das Gericht darf sich nicht über die Anträge der Parteien hinwegsetzen oder eigenständig Ansprüche zusprechen, die nicht geltend gemacht wurden. Die Parteien haben die Möglichkeit, im Rahmen des Verfahrens ihre Anträge zu modifizieren oder zu erweitern, aber die letztliche Entscheidung des Gerichts muss innerhalb des durch die Anträge gezogenen Rahmens bleiben.
Dieses Prinzip wahrt die Autonomie der Parteien im Zivilprozess und ist Ausdruck der Parteiherrschaft, die im österreichischen Rechtssystem stark verankert ist. Durch die Einhaltung des Grundsatzes „Ne ultra petita partium“ wird sichergestellt, dass Gerichte nicht übermäßig in die Dispositionsbefugnis der Parteien eingreifen und das Urteil auf das beschränkt bleibt, was tatsächlich Gegenstand des Streits war.
Durch diese Regelung wird auch die Rechtssicherheit gefördert, da die Parteien darauf vertrauen können, dass das Gericht nur über die gestellten Anträge entscheidet und nicht eigenmächtig andere Ansprüche berücksichtigt. Es ist daher für beide Prozessparteien essentiell, ihre Anträge klar zu formulieren und gegebenenfalls im Verlauf des Verfahrens anzupassen, um ihre Interessen bestmöglich vor Gericht durchsetzen zu können.