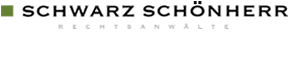Im österreichischen Strafrecht ist die Notwehr das Recht, einen gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden rechtswidrigen Angriff auf Leib, Leben oder bestimmte Rechtsgüter mit angemessenen Mitteln abzuwehren. Geregelt ist diese Rechtfertigung in § 3 StGB, wo festgelegt wird, dass eine Tat nicht rechtswidrig ist, wenn sie zur Verteidigung notwendig ist, um einen gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden Angriff abzuwehren.
Der Begriff der „Notwehrprovokation“ wird im österreichischen Recht nicht explizit in den Gesetzestexten genannt, spielt jedoch in der rechtlichen Praxis und Literatur eine Rolle. Er beschreibt eine Situation, in der der Notwehrübende den Angriff entweder bewusst oder fahrlässig selbst herausgefordert oder provoziert hat, um einen Notwehrgrund zu schaffen oder eine Reaktion auszulösen, die dann als Anlass für Notwehrhandlungen genutzt wird.
In solchen Fällen wird die Berechtigung zur Notwehr oder zumindest der Umfang der zulässigen Notwehrhandlungen eingeschränkt betrachtet. Das Prinzip ist, dass derjenige, der den Angriff absichtlich provoziert, um dann in Notwehr zu handeln, sich nicht auf Notwehr berufen kann, da diese Handlung missbräuchlich wäre. Die österreichische Judikatur geht im Allgemeinen davon aus, dass bei einer solchen Provokation die Notwehrhandlung unverhältnismäßig wäre, und somit die an sich gerechtfertigte Notwehrüberschreitung schärfer überprüft wird. Dies basiert darauf, dass das Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Verteidigung in einem ausgewogenen Verhältnis zum Angriff stehen muss.
Aus gesetzessystematischen Überlegungen ergibt sich, dass die Notwehrregelung die Notwendigkeit der rechtmäßigen Verteidigung bedeutet, und so ist bei einer absichtlichen Provokation die Erfüllung des Subsidiaritätsprinzips nicht gegeben. Eine Notwehrhandlung ist also dann nicht vollständig gerechtfertigt, wenn der Angriff durch den Verteidiger selbst in treuwidriger Weise initiiert wurde, es sei denn, der Angriff eskaliert unvorhergesehen in einem erheblich größeren Ausmaß.
In der Praxis bedeutet dies, dass die Umstände des Einzelfalles genau geprüft werden müssen, insbesondere die Frage, ob und in welchem Umfang der Notwehrübende tatsächlich die Situation provoziert hat, und ob alternative Möglichkeiten bestanden hätten, den Angriff zu vermeiden. Hierbei spielt auch die Intensität und Gefährlichkeit des Angriffs und der möglichen Verteidigungshandlung eine Rolle. Im Ergebnis ist das Ziel, einen Missbrauch des Notwehrrechts zu verhindern, um das Recht nicht für persönliche Racheakte oder Selbstjustiz nutzen zu lassen.