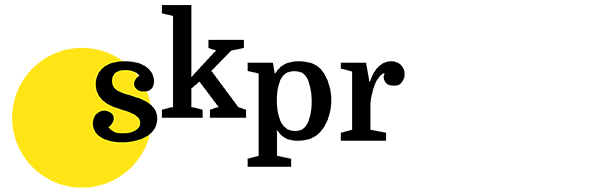Zunächst nimmt der Kaiser nur behutsam an der Rechtserzeugung teil. Er erlässt Edikte wie jeder Magistrat und trifft Entscheidungen, wenn er als Richter angegangen wird. Allmählich wird der Kaiser in die ordentliche Zivil- und Strafgerichtsbarkeit eingegliedert. Er nimmt sie in der Regel unter Beratung durch Fachjuristen wahr, die später als Juristen in des Kaisers Diensten im Namen des Kaisers judizieren. Die kaiserlichen Urteile heißen decreta. Sie bilden das Recht fort, indem sie gelegentlich Entscheidungen fällen, die neues Recht schaffen. Die rechtssetzende Funktion der kaiserlichen Rechtssprechung entwickelt sich dadurch, dass die zunächst für den Einzelfall geltenden Entscheidungen als Präjudizien vornehmlich durch die Juristenarbeit in das Juristenrecht einfließen. Im Wege der Anfragebeantwortung an Provinzstatthalter durch Brief epistula übt der Kaiser auf die Rechtssprechung der Statthalter Einfluss aus, wobei Rechtsauskunft und Rechtssetzung ineinander übergehen. Ab Hadrian beantwortet der Kaiser durch seine Kanzlei auch Rechtsanfragen von Privaten, seine Antworten erhalten den Richter bindende Funktion. Sie werden als Reskripte bezeichnet und werden in den Provinzhauptstädten am Sitz des Statthalters ausgehängt. Der Richter hat bloß noch das Zutreffen das in der Anfrage behaupteten Sachverhalts zu prüfen, die Rechtsfrage hat der Kaiser durch seine Zentralbürokratie, bereits entschieden. Damit sind die Reskripte das wichtigste Mittel, die Rechtseinheit im imperium herzustellen. Die Technik der Reskripte ähnelt dem Vorabentscheidungsverfahren in der EU, in dem der EuGH mit dem Ziel der Rechtsvereinheitlichung autoritativ Rechtsfragen des Gemeinschaftsrechts löst, der Ausgangsfall selbst aber von den nationalen Tribunalen entschieden werden muss.