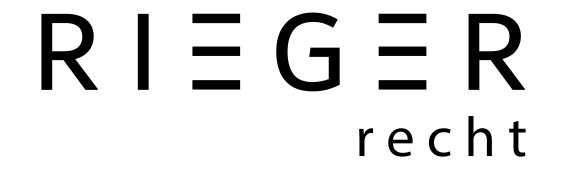Der Begriff „Reichspogromnacht“ bezieht sich auf die Ereignisse in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, als in Deutschland und Österreich, die damals Teil des Deutschen Reiches waren, gewalttätige Ausschreitungen gegen Juden stattfanden. Anders als im deutschen Recht wird der Begriff im österreichischen Recht nicht spezifisch in Gesetzen oder Paragraphen verwendet, da er historisch kontextbezogen ist und sich auf Ereignisse bezieht, die vor der Existenz der heutigen österreichischen Republik stattfanden. Es gibt jedoch Gesetze und Bestimmungen, die sich mit der Erinnerung an den Holocaust und den Schutz gegen antisemitische Handlungen befassen.
Im österreichischen Kontext nimmt das Verbotsgesetz 1947 eine zentrale Rolle ein. Dieses Gesetz wurde eingeführt, um den Nationalsozialismus zu verbieten und jede Wiederbetätigung zu ahnden. Es kriminalisiert die Wiederbetätigung im nationalsozialistischen Sinn und §§ 3ff. des Verbotsgesetzes nennt spezifische Straftaten und ihr Strafmaß, um eine Wiederholung derartiger Ereignisse wie der Pogromnacht zu verhindern.
Darüber hinaus schützt das österreichische Strafgesetzbuch (StGB) mit § 283 (Verhetzung) und § 188 (Herabwürdigung religiöser Lehren) Minderheiten vor Hass und Diskriminierung. Diese Paragraphen tragen dazu bei, rassistische oder antisemitische Übergriffe zu verhindern und zu bestrafen.
Österreich legt großen Wert auf die historische Aufarbeitung und das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Verschiedene Bildungsinitiativen und Gedenktage stellen sicher, dass die Öffentlichkeit über die Ereignisse der Reichspogromnacht und die Konsequenzen des Nationalsozialismus informiert bleibt. Dieses Erinnern und Gedenken wird oft durch staatliche und zivilgesellschaftliche Programme unterstützt, um sicherzustellen, dass solches Unrecht nie wieder geschieht.