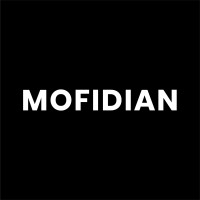Der Begriff „Reichsstift“ stammt ursprünglich aus dem deutschen Recht und der historischen Verfassung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Er bezeichnete eine kirchliche Einrichtung oder ein Kloster, das unmittelbar dem Kaiser unterstellt war und gewisse autonome Rechte besaß. Da Österreich ein bedeutender Teil des Heiligen Römischen Reiches war, hatten solche Einrichtungen auch eine historische Relevanz auf österreichischem Gebiet.
Im modernen österreichischen Recht wird der Begriff „Reichsstift“ nicht verwendet. Stattdessen gibt es Regelungen im Bereich des Kirchenrechts und in Angelegenheiten, die kirchliche Einrichtungen betreffen. Diese kirchlichen Einrichtungen werden durch Konkordate zwischen dem Heiligen Stuhl und dem jeweiligen Staat geregelt, in Österreich ist das Konkordat von 1933 von Bedeutung. Kirchliche Einrichtungen besitzen Rechte, die ihnen durch das Konkordat, das Kirchenrecht sowie durch das österreichische Staatskirchenrecht zugestanden werden. Dazu gehören unter anderem Rechte über den kirchlichen Besitz sowie über gewisse Steuern und Abgaben, die sie autonom verwalten dürfen.
Zusammengefasst spielt der Begriff „Reichsstift“ im Kontext des österreichischen Rechts keine direkte Rolle. Vielmehr sind es die modernen Regelungen im Verhältnis zwischen Staat und Kirche, die von Bedeutung sind, und diese beziehen sich auf Konkordate und spezifische Paragraphen im Staatskirchenrecht, wie zum Beispiel in der österreichischen Bundesverfassung (insbesondere in Art. 15, der sich mit den allgemeinen Grundrechten befasst) und im Konkordat mit dem Heiligen Stuhl.
Sollten Sie jedoch spezifisch eine Rechtsquelle benötigen, die sich auf kirchliche Fragen und Kircheneigentum im österreichischen Recht bezieht, lohnt es sich, in den Kirchlichen Gesetzblättern oder entsprechenden Bestimmungen in der österreichischen Rechtsordnung nachzuschlagen.