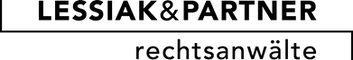Im österreichischen Recht ist der Begriff der „relativen Unwirksamkeit“ eher mit der Anfechtung nach der Insolvenzordnung (IO) verbunden. Im Gegensatz zu einer absoluten Unwirksamkeit bedeutet relative Unwirksamkeit, dass ein Rechtsgeschäft oder eine Rechtshandlung gegenüber bestimmten Personen oder unter bestimmten Umständen anfechtbar ist, ohne dass die Handlung an sich für jeden und alle Zeiten unwirksam wäre.
Die relative Unwirksamkeit wird insbesondere im Zusammenhang mit der Anfechtung von Rechtshandlungen innerhalb der Insolvenz betrachtet. Laut § 27 Insolvenzordnung können bestimmte Rechtshandlungen, die vor der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vorgenommen wurden, angefochten werden, wenn sie die Gläubiger benachteiligen. Diese Anfechtbarkeit macht die Rechtshandlung „relativ unwirksam“, weil sie zwar grundsätzlich gültig ist, aber im Kontext der Insolvenz angefochten werden kann, um den Massegläubigern gegenüber unwirksam zu sein.
Die Insolvenzordnung sieht verschiedene Anfechtungstatbestände vor, etwa die Schenkungsanfechtung (§ 29 IO), die Anfechtung wegen Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit (§ 30 IO), und die Anfechtung von Rechtshandlungen, die in der Absicht, Gläubiger zu benachteiligen, vorgenommen wurden (§ 31 IO). Die relative Unwirksamkeit bedeutet daher, dass die angefochtenen Rechtsakte gegenüber der Insolvenzmasse unwirksam sind und rückabgewickelt werden müssen, um die Gleichbehandlung der Gläubiger sicherzustellen.
Zusammengefasst bezieht sich die relative Unwirksamkeit im österreichischen Recht in erster Linie auf Anfechtungsrechte in der Insolvenzordnung. Diese ermöglichen es, bestimmte Rechtshandlungen, die vor der Insolvenz vorgenommen wurden und die Gläubiger benachteiligen, rückgängig zu machen oder als unwirksam gegenüber der Insolvenzmasse zu behandeln.