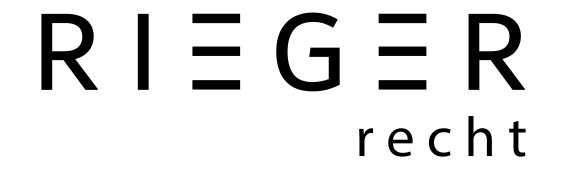Im österreichischen Recht ist der Begriff „sekundäre Darlegungslast“ kein fest etablierter Rechtsbegriff. Derartige Begriffe sind typischerweise dem deutschen Zivilprozessrecht zuzuordnen. Dennoch existiert in Österreich eine ähnliche Problematik bezüglich der Verteilung der Beweislast im Zivilverfahren, die analog betrachtet werden kann.
Im österreichischen Zivilrecht, vor allem im Zivilprozessrecht, regeln die §§ 266 ff. der ZPO (Zivilprozessordnung) die Beweisführung. Grundsätzlich obliegt die Beweislast demjenigen, der aus einem behaupteten Recht eine günstige Rechtsfolge ableiten möchte. Dies nennt man die primäre Beweislast. Dabei wird erwartet, dass die Partei alle Tatsachen darlegt und beweist, die für ihre Rechtsposition sprechen.
Es gibt jedoch Situationen, in denen das Wissen über bestimmte Tatsachen nicht gleich zwischen den Parteien verteilt ist. Wenn eine Partei offensichtlich weniger Information über das streitige Geschehen hat, kann eine sekundäre Darlegungslast in dem Sinne bestehen, dass die besser informierte Partei ihrem Konkurrenten das Notwendige darlegen oder zumindest ermöglichen muss, sich über die Beweise zu informieren. Diese Verpflichtung, Informationen bereitzustellen, ist nicht explizit als „sekundäre Darlegungslast“ im Gesetz verankert, jedoch ist sie in der Praxis und der Lehre durch eine flexible Handhabung der richterlichen Beweiswürdigung anerkannt.
Ein Beispiel, das diesen Gedanken stützen könnte, ist im Bereich der Produkthaftung oder bei Aufklärungs- und Informationspflichten zu finden. Hier muss die Herstellerseite oder die professionell agierende Partei oft detaillierte Einblicke in Produktionsprozesse, Qualitäten oder Risiken geben, während der Konsument solche Informationen nicht ohne weiteres besitzen kann.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es im österreichischen Recht keine festgeschriebene sekundäre Darlegungslast gibt, jedoch in der gerichtlichen Praxis ein gewisses Verständnis besteht, dass eine Partei, die bessere Kenntnis oder Zugang zu relevanten Informationen hat, eine erweiterte Mitwirkungspflicht bei der Sachverhaltsaufklärung trägt. Diese Praxis dient dazu, die Fairness im Verfahren zu gewährleisten und der Frage von asymmetrischem Informationszugang gerecht zu werden.