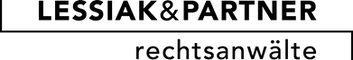Im österreichischen Recht umfasst der Begriff „Willkür“ im Wesentlichen das Handeln von Behörden oder staatlichen Organen, das ohne sachliche Rechtfertigung und ohne klaren gesetzlichen Rahmen erfolgt. Willkür ist insbesondere im Verwaltungsrecht ein zentraler Aspekt, da der Staat verpflichtet ist, im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit zu handeln und somit Willkür zu vermeiden.
Ein wesentliches Prinzip, das eine willkürliche Rechtsanwendung verhindern soll, ist der Gleichheitssatz gemäß Artikel 7 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG). Dieser garantiert, dass alle Staatsbürger vor dem Gesetz gleich sind. Die Behörden müssen ihre Entscheidungen auf sachliche Gründe stützen und dürfen keine ungerechtfertigten Unterscheidungen treffen. Willkür liegt daher vor, wenn eine Entscheidung ohne nachvollziehbare sachliche Grundlage getroffen wird und somit gegen den Gleichheitssatz verstößt.
Ebenso ist das Legalitätsprinzip gemäß Artikel 18 B-VG einschlägig, das die Ausübung der Verwaltung und der Rechtsprechung an die gesetzlichen Vorgaben bindet. Dieses Prinzip ist eine fundamentale Schutzvorrichtung gegen Willkür. Die Verwaltung ist verpflichtet, nur auf Grundlage von formalisierten Gesetzen zu handeln, was willkürliches Verhalten verhindern soll.
Im Rahmen der Grund- und Menschenrechte spielt der Schutz vor willkürlichem staatlichen Handeln eine ebenfalls bedeutende Rolle. So verlangt die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), die in Österreich Verfassungsrang hat, dass Eingriffe in die Rechte und Freiheiten ohne Willkür und im Einklang mit der Konvention erfolgen.
Zusammengefasst stellt Willkür im österreichischen Recht einen erheblichen Verstoß gegen die Prinzipien der Gleichbehandlung, Gesetzmäßigkeit und Rechtssicherheit dar. Eine erfolgreiche Anfechtung aufgrund von Willkür setzt daher voraus, dass eine Entscheidung ohne sachliche Rechtfertigung, diskriminierend oder ohne festen gesetzlichen Boden getroffen wurde.